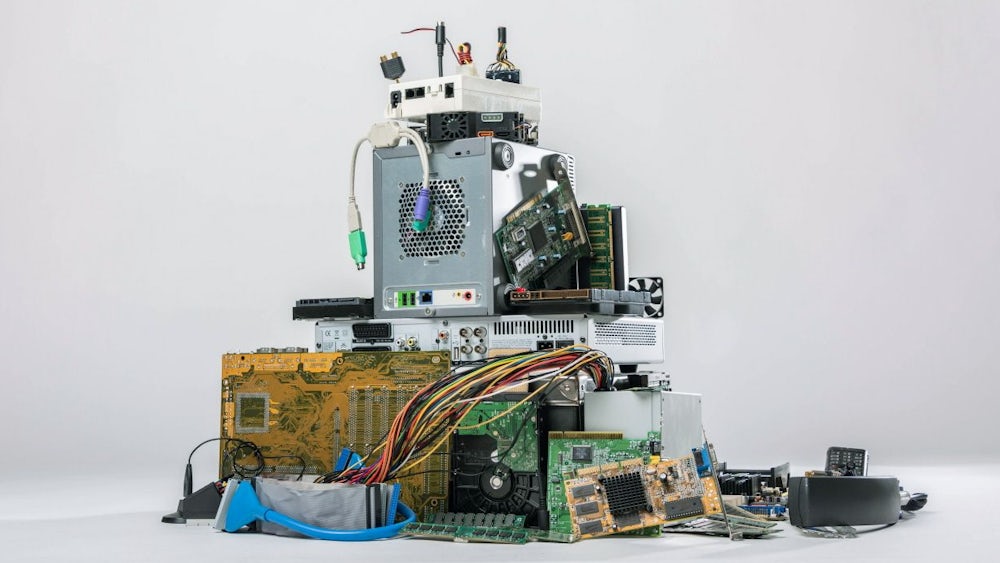Wenn die älteren Modelle eines großen amerikanischen Handy-Herstellers mit jedem Software-Update immer langsamer werden oder nach einem Akku-Austausch durch eine freie Werkstatt den Batteriezustand überhaupt nicht mehr anzeigen. Wenn der Drucker verkündet, dass die Patronen leer sind, obwohl immer noch Tinte für viele Seiten darin enthalten ist - dann sind das aktuelle Beispiele dafür, wie Software eine an sich einwandfrei funktionierende Hardware entwertet und im schlimmsten Fall unbrauchbar macht. Nachweisen lässt sich die Vorgehensweise der sogenannten geplanten Obsoleszenz selten. Und ebenso selten geben die Hersteller derartige Eingriffe zu: So drosselte Apple nach eigenen Angaben die Leistung der älteren iPhones, um Akkus zu schonen.
Denn eigentlich ist Software ein sehr nachhaltiges und genügsames Produkt, das sich wie ein Roman oder eine Partitur nicht abnutzen kann, erklärte der Zürcher Informatikprofessors Lorenz Hilty bei einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing. Doch die Geschäftsstrategien der IT-Industrie laufen dieser Theorie zuwider. Da gibt es zum einen die software-induzierte Obsoleszenz, das heißt, die Ansprüche der Software steigen mit jeder neuen Entwicklung, sie will mit dem Effizienzfortschritt der Hardware ("Moore's Law") mithalten. So braucht etwa Windows 10 im Vergleich zu Windows 95 ganze 40 Mal so viel Prozessorleistung, 250 Mal so viel Arbeitsspeicherkapazität und 320 Mal so viel Festplattenplatz.
Zudem, so Hilty, ist Software immer fehlerhaft und mittlerweile auch überkomplex. Dadurch hat sie ein massives Sicherheitsproblem, das Hacker ausnutzen können. Zwar bieten die Hersteller durch Sicherheits-Updates an, diese Lücken zu schließen, aber meist hören sie nach einiger Zeit auf, die hauseigene Software zu verbessern. So erzwingen sie das Ende der Software. Nutzer können sie nicht mehr ohne Risiko verwenden und das macht letztlich oft auch die Geräte wertlos, auf denen sie läuft.
Von "programmierter Obsoleszenz" spricht Hilty, wenn der Softwarecode explizite Anweisungen enthält, wie zum Beispiel, dass nach einem Update die Leistung eines Gerätes gedrosselt werden soll. Aber auch Zähler in Druckern, die nach 10 000 Druckvorgängen oder einer bestimmten Anzahl an Ladyzyklen bei Akkus ihren Dienst quittieren, fallen unter diese Kategorie. Genauso wie Ersatzteile anderer Hersteller, die die Software ohne technisch ersichtlichen Grund einfach nicht erkennen will. Die IT-Unternehmen nutzen mit solchen Strategien die Informations-Asymmetrien, die gerade bei digitalen Technologien sehr groß sind.
Verbraucher sollten ein Recht auf Reparatur haben
"Der Nutzer weiß nichts, der Hersteller weiß alles und hinterher weiß er viel über den Nutzer", sagt Hilty. Selbst wenn der Quellcode wie bei freier oder Open-Source-Software offen liege, brauche man viel Fachwissen, um das alles zu verstehen. Softwareprodukte seien also Vertrauensgüter, man habe praktisch keine Möglichkeit, sich im Voraus über deren Qualität zu informieren. Man könne sich lediglich - wie bei einem Arztbesuch - auf fremde Erfahrung verlassen und müsse dem Anbieter vertrauen. Und diese Orientierungslosigkeit der Kunden nutzten die IT-Hersteller wiederum aus, um sie an sich zu binden. So ist das eine Betriebssystem nicht mit Apps oder Anwendungen anderer Hersteller kompatibel oder Musikdateien laufen nur auf einem bestimmten Player.
Lassen sich diese Probleme überhaupt lösen und wenn ja, wie? Lorenz Hilty befürchtet, dass sich durch Trends wie das "Internet der Dinge", also immer mehr smarte software-gesteuerte und internetfähige Geräte wie Lampen, Heizungen und Türklingeln, das Problem eher verschärfen wird. "Wir werden durch sinnlosen Konsum steuerbar. Irgendwann müssen wir umziehen, weil im smarten Home die Rollläden nicht mehr funktionieren und die Tür nicht mehr aufgeht."
Kampflos aufgeben will er aber nicht. So fordert er auch in der EU ein "Recht auf Reparatur" für Elektrogeräte, wie es das in einigen US-Bundesstaaten für Autos bereits gibt. Jeder, der ein Produkt besitzt, soll demnach das Gerät selbst reparieren, es überall reparieren lassen oder einen anderen Ausgleich erhalten können. Hersteller sollen durch das Gesetz Ersatzteile auch an unabhängige Werkstätten verkaufen müssen. Und neben Ersatzteilen sollen die Hersteller ihren Kunden Reparaturanleitungen und Diagnosewerkzeuge zugänglich machen und zudem auch den Quellcode der Software offen legen.
Dieses Recht reicht Hilty allerdings nicht. Er fordert, analog zum Recht auf informationelle Selbstbestimmung, ein "Recht auf materielle Selbstbestimmung". Es könne doch nicht sein, dass Sachgüter, die man als Eigentum erworben hat, dauerhaft unter Kontrolle des Herstellers bleiben und von diesem jederzeit entwertet werden können.