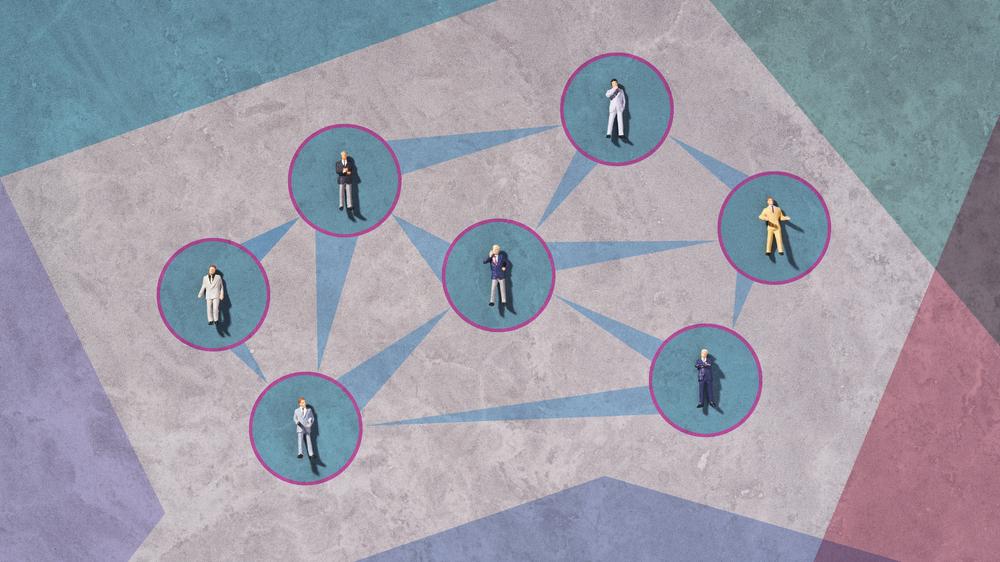"Einmal Zoomen statt Bahn spart 90 Prozent Treibhausgase" – Seite 1
Die Digitalisierung hat das Potenzial, die Gesellschaft zu verändern, die Wirtschaft zu demokratisieren und den Klimawandel aufzuhalten. Das hat die Pandemie gezeigt, sagt der Transformationsforscher Tilman Santarius. An der TU Berlin untersucht er, wie digitale Technik den Alltag der Menschen verändert und welche Chancen darin stecken.
ZEIT ONLINE: Herr Santarius, wie viel Zeit verbringen Sie momentan in Videokonferenzen?
Tilman Santarius: Sehr viel, so wie viele andere Menschen auch. Ich lebe in Gransee, einer Kleinstadt im Norden Berlins, und mein beruflicher Austausch findet derzeit komplett übers Internet statt. Dadurch kann ich hier am Ort sehr präsent sein. Ich finde, das ist eine gute Kombination. Der Gedanke kommt in der Corona-Krise ja viel zu kurz.
ZEIT ONLINE: Welcher Gedanke?
Santarius: Die Hoffnung, dass wir unser Leben aufgrund der Erfahrungen, die wir gegenwärtig in der Pandemie machen, künftig viel schlauer organisieren könnten. Damit meine ich selbstverständlich nicht, dass wir uns auch in Zukunft voneinander fernhalten sollen. Wir haben ja in den vergangenen Monaten begriffen, wie wichtig unmittelbare zwischenmenschliche Begegnungen für uns sind und wie sehr sie fehlen.
ZEIT ONLINE: Worin sehen Sie dann das Positive?
Santarius: Wir haben in der Pandemie gelernt, wie gut wir die digitale Technik nutzen können, um unsere sozialen Kontakte über große Entfernungen hinweg zu pflegen. Das sollten wir beibehalten, auch wenn wir hoffentlich bald wieder zu einem menschenfreundlicheren Alltag zurückkehren. Wenn es uns gelänge, unser Leben auch künftig radikal lokal zu gestalten – nur eben mit erfüllenden zwischenmenschlichen Begegnungen statt auf sozialer Distanz –, dann wäre für Umwelt und Gesellschaft sehr viel gewonnen.
ZEIT ONLINE: Und dabei helfen uns Videotelefonate?
Santarius: Nicht nur. Aber sie erlauben uns internationalen Austausch, ganz ohne fliegen zu müssen. Viele Dienstreisen und das Pendeln ins Büro werden durch sie überflüssig. Dadurch gewinnen wir unglaublich viel Zeit. Und vor allem vermeiden wir den Ausstoß von Treibhausgasen. Ein Beispiel: Das Berliner Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung kam in einer Analyse im Auftrag von Greenpeace zu dem Ergebnis, dass ein zusätzlicher Homeoffice-Tag in Deutschland 1,6 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen könnte. Und das ist noch konservativ gerechnet.
ZEIT ONLINE: Lassen Sie uns einmal bei den Zahlen bleiben. Wie sehr steigen Energiebedarf und Emissionen durch die stärkere Nutzung von Videokonferenzen in der Pandemie?
Santarius: Nicht sehr viel,
solange man es nicht übertreibt. Eine Stunde Zoomen zwischen zwei Laptops bei
HD-Qualität verbraucht ungefähr ein Gigabyte an Datenvolumen. Das entspricht
etwa 0,01 Kilowattstunden Strom und verursacht eine Emission von 3,8 Gramm CO2
– vorausgesetzt, man nimmt den aktuellen deutschen Strommix als Basis. Der
Energiebedarf der Rechner selbst ist dabei nicht berücksichtigt, denn man geht
davon aus, dass sie während der Arbeit ohnehin laufen. Wichtig ist: Man muss diesen Treibhausgasausstoß verrechnen mit den
eingesparten Emissionen, vor allem durch entfallene Dienstreisen. Schaut man sich etwa eine Bahnfahrt von München nach Hamburg an, dann spart einmal Zoomen statt Bahn 90 Prozent der Treibhausgase.
"HD-Qualität auf dem Smartphone ist unnötig"
ZEIT ONLINE: Schulen in ganz Deutschland nutzen ebenfalls Videokonferenzen statt Präsenzunterricht. Gibt es Erkenntnisse über deren Energiebedarf?
Santarius: Für eine Schulstunde mit rund zwanzig Kindern benötigt man unter den gleichen Bedingungen ungefähr 0,7 Kilowattstunden Strom, selbst wenn alle ihre Kamera die ganze Zeit über anlassen. Dadurch entstehen knapp 260 Gramm CO2-Emissionen – das ist ungefähr so viel wie eine Einkilometerfahrt mit einem Luxusauto. Schaltet man die Kamera aber aus, spart man als Teilnehmer einer Videokonferenz mehr als 90 Prozent des Stromverbrauchs.
ZEIT ONLINE: Videostreaming ist in der Pandemie sehr beliebt. Wie sieht es damit aus? Dadurch spart man keine Dienstreisen.
Santarius: Die Zahlen dazu schwanken stark. Es gibt aber eine Faustregel: Um einen Film auf Netflix oder Amazon Prime zu sehen, verbraucht man in der gleichen Zeit ungefähr drei Mal so viel Datenvolumen wie durch eine Zoom-Videokonferenz. Wie hoch der Energiebedarf dafür konkret ist, hängt dann allerdings von mehreren Faktoren ab. Wie groß ist der Bildschirm? Mit welcher Auflösung schaut man? Streamt man übers Glasfasernetz, über Kabel, vielleicht sogar übers mobile Datennetz?
Das Borderstep Institut hat das im vergangenen Jahr einmal an mehreren Beispielen durchgerechnet. Ein Ergebnis: Eine Stunde Videostreaming in Full HD aufs Smartphone verursacht rund 100 Gramm CO2. Wer das gleiche Video in 8K-Qualität auf einem 65-Zoll-Bildschirm anschaut, setzt dadurch 880 Gramm CO2 frei.
ZEIT ONLINE: Ganz schön viel.
Santarius: Und man darf nicht vergessen, dass Videostreamings schon jetzt 60 bis 70 Prozent der globalen Datenströme ausmachen. Die allermeisten Prognosen gehen davon aus, dass der Anteil in etwa so hoch bleibt – allerdings bei stark wachsendem Datenvolumen insgesamt. Da gäbe es schon Einsparpotenzial.
Man könnte beispielsweise darauf verzichten, ständig überall Werbevideos einzubauen, die dann auch noch automatisch abgespielt werden. Außerdem könnte jede und jeder Einzelne durch eine verringerte Auflösung beim Streaming viel sparen. HD-Qualität auf einem Smartphone- oder Tabletbildschirm ist ziemlich unnötig.
ZEIT ONLINE: Die Produktion von Laptops, Tablets oder Fernsehern verursacht ebenfalls Emissionen.
Santarius: Wenn wir die Digitalisierung so verstehen, dass wir immer neue Geräte besitzen möchten, trägt das natürlich nichts zum Klimaschutz bei. Zumal viele Länder des globalen Südens da noch ganz am Anfang stehen. Die Produktion von Hardware ist in den vergangenen Jahren jedes Jahr um vier Prozent energieintensiver geworden.
ZEIT ONLINE: Was bedeutet das?
Santarius: Um ein beliebiges Elektrogerät herzustellen, braucht man jedes Jahr vier Prozent mehr Energie. Fast in allen anderen Branchen arbeiten die Fabriken immer energieeffizienter. Nur in der Hardwareproduktion ist das nicht so, weil die Geräte stetig größer und leistungsfähiger werden. Umso wichtiger wäre es, dass wir die Digitalisierung nicht nur dazu nutzen, um technisch immer weiter aufzurüsten. Sondern für soziale Innovationen.
"Durch 3-D-Druck könnte man Rohstoffe sparen"
ZEIT ONLINE: Steigen die Emissionen in der Hardwareproduktion im gleichen Tempo wie der Energieverbrauch?
Santarius: Das kommt darauf an, welche Energiequellen die Fabriken nutzen. Die meisten Geräte werden in China hergestellt. Ihre Herstellung verbraucht also größtenteils Kohlestrom. Solange sich der Energiemix Chinas nicht ändert, steigen die Emissionen der Fabriken im gleichen Tempo.
ZEIT ONLINE: Jeder und jede Deutsche verursacht im Jahr durchschnittlich Treibhausgasemissionen von zwölf Tonnen CO2. Das ist mehr als das Zehnfache der Menge, die noch als klimaverträglich gelten würde. Wie groß ist der Anteil der Digitalisierung daran?
Santarius: Das haben die Kollegen vom Öko-Institut ausgerechnet. Etwa 0,85 Tonnen der Pro-Kopf-Emissionen werden durch die Digitalisierung verursacht. Also durch die Herstellung von Smartphones und Laptops, ihren Betrieb, den Energiebedarf von Datennetzen und Rechenzentren. Das entspricht einem Anteil von sieben Prozent – das ist nicht gerade wenig. Allerdings verursachen Mobilität oder Wohnen nach wie vor deutlich mehr Emissionen.
ZEIT ONLINE: Sie sagen, es komme darauf an, die Digitalisierung menschenfreundlich zu nutzen. Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
Santarius: Digitale Technik erlaubt es uns, die Produktion von Waren viel näher an den Verbraucherinnen und Verbrauchern anzusiedeln. Viele Transportwege könnten dadurch überflüssig werden, der Ausstoß klimaschädlicher Gase würde stark sinken.
ZEIT ONLINE: Bisher wurde die digitale Technik doch vor allem dazu genutzt, die globalen Lieferketten der Industrie möglichst reibungslos zu organisieren. Wo ist da die Rückbesinnung aufs Lokale?
Santarius: In den Neunzigerjahren haben die Unternehmen begonnen, ihre Produktionswege mit Hilfe von Intranetzen global zu organisieren. Damals ging es tatsächlich vor allem um schnelle Kommunikation und die möglichst zeitsparende Koordination von internationalen Just-in-time-Lieferbeziehungen.
Aber heute wird die Fertigung selbst digital gesteuert, und das ist neu. Eine Fabrik, in der sämtliche Maschinen digital untereinander vernetzt sind, lässt sich viel effizienter organisieren. Man braucht weniger Rohstoffe und weniger Energie – vorausgesetzt, man nutzt die Einsparungen nicht, um das Wachstum weiter zu erhöhen. Letzteres schadet dem Klima, weil die Einsparpotenziale dann wieder verpuffen.
ZEIT ONLINE: Welche neueren Innovationen gibt es noch, die dem Klima nutzen könnten?
Santarius: Durch 3-D-Druck könnte man ebenfalls Rohstoffe sparen und auch Arbeitsaufwand in der Produktion. Schuh- oder Textilhersteller holen beispielsweise mittlerweile ihre Produktion aus Asien zurück nach Europa. Sie können hier ebenso günstig und gut produzieren. Sie müssen ihre Rohstoffe, Vorprodukte und zum Beispiel die fertige Jeans nicht mehr mehrfach um den Globus schippern, bis die Hose am Ende bei uns verkauft wird. Auch auf diesem Weg nützt die Digitalisierung dem Klima.
ZEIT ONLINE: Aber auch für den 3-D-Druck braucht man Rohstoffe und Energie.
Santarius: Ja, aber weniger als in herkömmlichen Fertigungsverfahren.
ZEIT ONLINE: Sie sagen, der Konsum könne sich mit Hilfe digitaler Technik ebenfalls viel stärker regional organisieren. Auch das würde dem Klima nützen, aber im Moment beobachten wir doch eher das Gegenteil: Der Umsatz von international aktiven Online-Händlern wie Amazon steigt und steigt.
Santarius: Ja, darin liegt tatsächlich ein Risiko. Aber niemand zwingt uns, das Feld globalen Konzernen zu überlassen. Ebenso gut könnten wir lokale E-Commerce-Plattformen aufbauen, um den ortsansässigen Einzelhandel zu stärken. Wenn dann noch Kuriere die Waren mit dem Fahrrad ausliefern würden, statt mit dem Kleintransporter, hätten Umwelt und Gesellschaft viel gewonnen. Wenn wir es klug angehen, gewinnen wir so eine viel stärkere Kontrolle darüber, was wir herstellen, wo wir es kaufen und wie wir es gemeinsam nutzen.
"Die Digitalisierung kann die Wirtschaft demokratisieren"
ZEIT ONLINE: Sie spielen auf Sharing-Modelle an: Nachbarn könnten sich eine Bohrmaschine oder ein Auto teilen. Car-Sharing funktioniert ja bereits, aber ansonsten haben sich auch in der Sharing Economy bisher eher profitorientierte Konzerne in großem Maßstab durchgesetzt.
Santarius: Die entscheidende Frage ist doch: Wer kontrolliert die Digitalisierung? Wer bietet die Plattformen an, über die wir uns organisieren? Sind es zentral gesteuerte, global aktive, gewinnorientierte Unternehmen? Oder ist es eine kommunale Car-Sharing-Initiative, oder ein Netzwerk aus Nachbarn? Mir geht es um das Teilen von Waren und Dienstleistungen unter gleichberechtigten Anwohnern. Das ist etwas anderes als der Sharing-Kapitalismus á la Uber oder Airbnb. Richtig verstanden, kann die Digitalisierung die Wirtschaft demokratisieren.
ZEIT ONLINE: Ist es schon Demokratie, sich eine Bohrmaschine zu teilen, anstatt sich eine eigene zu kaufen?
Santarius: Natürlich nicht. Aber durch digitale Tools können die Menschen von reinen Konsumenten zu Prosumenten werden. Sie stellen selbst her, was sie brauchen, zum Beispiel durch 3-D-Druck in offenen Werkstätten. Richtig gestaltet, birgt Digitalisierung das Potenzial, uns die Kontrolle über die Produktionsmittel zurückzugeben.
ZEIT ONLINE: Schön und gut, aber woher sollen wir jetzt auch noch die Zeit nehmen, um die Produktionsmittel selbst zu nutzen? Arbeitsteilung hat doch auch ihre Vorteile.
Santarius: Meine eigenen empirischen Untersuchungen zeigen: Je digitaler man lebt, also je mehr Stunden man täglich online ist, je mehr Smartphone-Apps man benutzt und je mehr Endgeräte man besitzt, desto größer ist der Alltagsstress. Das ist nicht nur psychologisch bedingt, sondern das habe ich objektiv gemessen. Stark digitalisierte Menschen packen ihre Tage oft sehr voll. Statt die Zeit, die sie beispielsweise durch eine schnellere Kommunikation sparen, kreativ zu nutzen, kommunizieren sie nur noch mehr.
ZEIT ONLINE: Und während wir hier über die Chancen der Digitalisierung reden, haben manche Regionen Deutschlands immer noch kein schnelles Netz.
Santarius: Von der örtlichen Infrastruktur hängt natürlich vieles ab. In der Vergangenheit hat die Politik den Glasfaserausbau vernachlässigt. Und statt lokaler Mobilität, also zum Beispiel Sammeltaxen oder Mitfahrgelegenheiten im ländlichen Raum, hat sie leider immer noch Autobahnen oder den Berliner Großflughafen finanziert. Wenn wir lebendige Kleinstädte und Dörfer wollen, mit regionaler Produktion und lebendigem Einzelhandel, muss sich das ändern.
ZEIT ONLINE: Und wann gehen Sie in ihre nächste Videokonferenz?
Santarius: Ich habe heute glücklicherweise nur noch einen einzigen Videotermin. Den Rest des Tages kann ich für konzeptionelle Arbeit nutzen: um nachzudenken und zu schreiben.
Die Digitalisierung hat das Potenzial, die Gesellschaft zu verändern, die Wirtschaft zu demokratisieren und den Klimawandel aufzuhalten. Das hat die Pandemie gezeigt, sagt der Transformationsforscher Tilman Santarius. An der TU Berlin untersucht er, wie digitale Technik den Alltag der Menschen verändert und welche Chancen darin stecken.
ZEIT ONLINE: Herr Santarius, wie viel Zeit verbringen Sie momentan in Videokonferenzen?
Tilman Santarius: Sehr viel, so wie viele andere Menschen auch. Ich lebe in Gransee, einer Kleinstadt im Norden Berlins, und mein beruflicher Austausch findet derzeit komplett übers Internet statt. Dadurch kann ich hier am Ort sehr präsent sein. Ich finde, das ist eine gute Kombination. Der Gedanke kommt in der Corona-Krise ja viel zu kurz.